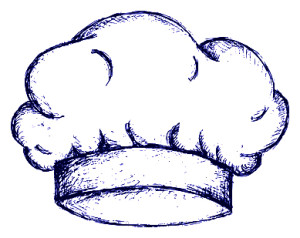„Genug ist nicht genug!
Küche und Eigensinn“
Thomas Platt
Dass ein Dackel Befehle lediglich als Serviervorschlag betrachtet und ungeachtet Ihrer Insistenz und Lautstärke dem selbst gewählten Tagewerk partout weiter nachgeht, gehört zu den eminenten Vergnügen, die wohl kaum ein verständiger Halter missen möchte.
Auch wenn diese Form der Selbstbewahrung einem tüchtig auf die Nerven zu gehen vermag, so bleibt doch auch ein Gegenstand der Bewunderung. Denn Eigensinn, wie er beileibe nicht nur bei störrischen Hunden vorkommt, gehört zu den Voraussetzungen erfinderischen Geistes. Wer jedoch zuvörderst aus sich heraus lebt und unbeirrt Ziele verfolgt, sieht sich rasch dem Verdacht ausgesetzt, nicht allein Egozentriker zu sein, sondern womöglich gar auch noch ein Egoist. Nirgends kann derlei besser widerlegt werden, als an einem Ort, der zwar seit jeher aus gemeinschaftlichem Interesse existiert, aber zugleich wie kaum ein anderer individuelle Entfaltung mit greifbaren Ergebnissen ermöglicht.
Nämlicher Ort gilt als Sammelpunkt und Reservoir unzähliger Ideen, die sich zu Mustern ordnen, um dann als Rezepte ihrer Brauchbarkeit unter Beweis zu stellen. Um sich darin nicht zu verlieren, bedarf es schon einer Existenz, die in erster Linie sich selbst folgt. Der Eigensinnige scheint dafür wie gemacht. Denn bei all seinen Vorstellungen, Phantasien und Visionen ist die Tat nicht bloß mitgedacht. Sie ist ihr Ausgangspunkt. Sie wird gegen inneren und äußeren Widerstand begangen.
Wir reden von der Küche. Sieht man von einigen Hobbyköchen ab, die im besagten Ort ein Ventil für ihr querolantes Wesen gefunden haben, so öffnet sich dem Eigensinnigen rund um den Herd ein ideales Feld. Denn kaum irgendwo anders liegen Gedanke und Wirklichkeit für den Schaffenden so nahe beieinander, dass sie sich förmlich zu berühren und gegeneinander zu verschieben scheinen. Man könnte hier nicht etwa von Reibungsverlust sprechen, sondern tatsächlich von Reibungsgewinn. Ein bestens beleumundetes Restaurant in Berlin führt das geradezu beispielhaft vor.
Eigentlich hätten Fachkenner bereits aus der persönlichen Entscheidung des Küchenchefs folgern können, dass es mit den Menüs eine Bewandtnis haben muss, die über das rein Kulinarische hinausstößt. Denn seine stille, fast grüblerische und dabei völlig unprätentiöse Art verrät den Denker hinter einem handwerklichen Geschick, das allerdings stupend ist. Deshalb spielt der Einsatz von Luxusprodukten sowie deren formvollendete Präsentation keine so große Rolle wie in vergleichbaren Restaurants der Sterneklasse. Vielmehr bewegt den Gast etwas schwer Fassbares, das mit dem außer Mode gekommenen Wort „Geist“ gut bezeichnet wird. Jedenfalls spiegeln die Werke des Meisterkochs wider, dass feine Küche in ein Abenteuer des Denkens verwandelt werden kann. Darum erhalten Zutaten dieser Küche den Status des Akzidentiellen. Zunächst.
Dennoch gibt es Kaviar und Gänseleber. Aber sie befinden sich im Rang von Zitaten, die in einen Text aufgenommen wurden, um eine These mit Autorität zu versehen – oder in dem von Worten und Sätzen, die poetische Intuition zu vergegenwärtigen. Ja, im Ernst, man kann diesen Mann im Rahmen eines erweiterten Literaturbegriffs durchaus als Dichter mit Kochhaube verstehen, dessen Sprache vom Gaumen durchbuchstabiert wird – die aber zugleich immer auch dem Intellekt verständlich bleibt. Der Vorteil einer solchen Interpretation der Gestalt des Kochs liegt auf der Hand: Er öffnet dem Connaisseur eine Leidenschaft voller Assoziationen sowie Querverweise und stellt ein Vokabular zu Verfügung, das beispielsweise in den Feuilletons der großen Zeitungen jeden Tag erprobt wird.
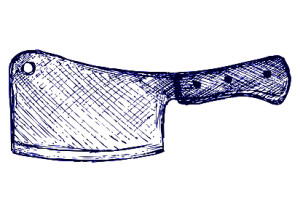
Mit vier, fünf Gabelstichen wird bei dem, was sich auf der Karte schlicht „Salatblätter, Venusmuscheln und Austernextrakte“ nennt, ein Thema nach dem anderen angeschlagen und erschöpft behandelt, so dass der Wunsch nach mehr gar nicht erst entstehen kann. Überhaupt jeder Bissen, den der Gast im Verlaufe eines Abends zum Mund führt, wartet mit einem neuen Aspekt, einer kleinen Attraktion auf – das kann ein Säurepunkt sein bei den marinierten Kartoffelsorten (Assoziation wäre „My Antonia“ von Willa Cather), eine nach Mole riechende Emulsion bei den Venusmuscheln, Senfkörner zwischen dem Kaviar, Petersilie und dann Rhabarber, gefolgt vom röstigen Ton gepuffter Roggenkörner beim mit der Delikatesse von Passagen in Prousts „Im Schatten junger Mädchenblüte“ angerichteten Kaisergrant, eine Note von Maissüße beim Limande- Plattfisch- Filet, bayerischer Radi und gleich darauf Sonnenblumenkern zum Lammrücken oder die süße Mineralität von Meersalz auf dem Kalbsmark. Der selbstherrlichen Subtilität dieses Hauptganges entspricht die Darstellung des Eigensinns in Evelyn Waughs „Wiedersehen mit Brideshead“
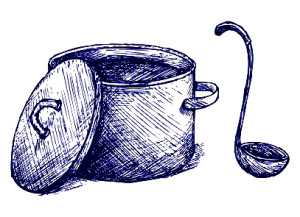
Dass man den ganzen Abend über nicht einmal daran denk, der oder jener Garpunkt könnte verfehlt gewesen sein, spricht für die Souveränität dieser Küche der Bezüge. Und noch mehr für die ‚ Makellosigkeit ihres Stils, der von dialogischer Schlagfertigkeit, dem szenischen Reichtum aus Noten und Nuancen, von Mikrointervallen lebt, In der Summe erinnert das an Conrad Ferdinand Meyers Gedicht „Genug ist nicht genug“, in dem es heißt:“ Das Herz, auch es bedarf des Überflusses,/ Genug kann nie und nimmermehr genügen!“
Auch wenn in diesem Lokal jedem Detail etwas Unvermeidliches, ja Wesentliches – sie also vom Koch ihres anfänglich akzidentiellen Status enthoben werden – zukommt, wecken die Arrangements auf dem Teller den Eindruck, als habe durchaus auch der Gott des Zufalls seine Finger im Spiel. Etwas so, als könne allein er garantieren, dass Tradition und mit ihr jene ererbten Privilegien, die sich einzelne Zutaten in der Geschichte der Gourmandise erworben haben, nicht überhand nehmen. Hier wendet der Koch also ein Verfahren an, das in der modernen Schriftstellerei häufig erprobt wurde. In Wirklichkeit sind die Kompositionen zu einem nicht unbedingt immer fröhlichen Ende gedacht. Ein solch weniger Erbauliches kann auch dem Teckeltier blühen, wenn es den Pfiff seines Herren überhört.
Copyrights Porträt & Text: © Thomas Platt Illustration: © Kreatiw – Fotolia